Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
To be continued...
Fortsetzung:
Der Prozess würde der Energieerhaltung widersprechen. Gehen wir ins Ruhsystem des einlaufenden Elektrons. Dort beträgt die Energie des einlaufenden Elektrons E = m = 511 keV. Das auslaufende Elektron und das emittierte Photon haben jeweils einen nichtverschwindenden Impuls p. Die Energie des auslaufenden Elektrons wäre somit E = sqrt(m^2 + p^2) > m, die Energie des emittlerten Photons E = p > 0. Die Gesamtenergie von auslaufendem Elektron und emittiertem Photon wäre somit auf jeden Falls größer als die Energie des einlaufenden Elektrons von 511 keV, was die Energieerhaltung verletzen würde. Deswegen ist dieser Prozess nicht möglich.
Abgesehen davon würde dieser Prozess bedeuten, dass ein Elektron einfach so, ohne äußeren Einfluss, Photonen emittieren könnte. Das wäre schon sehr seltsam, wenn es das gäbe.
Prozesse, bei denen ein Elektron ein Photon emittiert, z.B. bei der Bremsstrahlung, setzen voraus, dass ein äußerer Einfluss vorhanden ist, im Fall der Bremsstrahlung ist das ein externes EM-Feld. Das zugehörige Feynman-Diagramm sieht so aus, dass das einlaufende Elektron an einem Vertex mit dem externen Feld (hier mit "Kern" markiert) zusammentrifft, von diesem Vertex dann ein virtuelles Elektron zu einem zweiten Vertex läuft, von dem aus das auslaufende Elektron und das emittierte Photon ausgesandt werden:
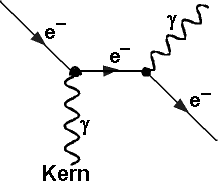
Im Ruhsystem des einlaufen Elektrons betrachtet wird die Energieerhaltung hier dadurch gewährleistet, dass die vom auslaufenden Elektron und emittierten Photon benötigte zusätzliche Energie vom externen Feld bereitgestellt wird.
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen
Zitat von Halman
Beitrag anzeigen







Einen Kommentar schreiben: